Der Stoff, aus dem der Stoff ist
Kleidung aus Schurwolle ist auch heute noch allgemein bekannt. Die folgende Dokumentation bietet einen Überblick der einzelnen Arbeitsschritte, die notwendig sind, um aus dem Fell eines Tieres ein historisches Kleidungsstück zu fertigen.Wenn wir von „Wolle“ reden, ist nahezu ausschließlich Schurwolle vom Schaf gemeint. Ziegenwolle wurde im Mittelalter wohl nur in geringen Mengen verarbeitet und Cashmere, Mohair und Merino-Wolle stammen von Ziegen- bzw. Schafrassen, die in unseren Breiten nicht verbreitet waren. Alpaka und Lamawolle waren in Europa noch unbekannt und die Verwendung von reiner Baumwolle ist in Deutschland erst ab der Mitte des 14. Jhd. nachgewiesen.Wolle kann über ein Drittel ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen und leitet die aufgenommene Flüssigkeit schnell nach außen ab, anders als z.B. Baumwolle. Die Struktur der Wollfaser ist schmutzabweisend, durch ihre Elastizität knitterarm und sehr farbbeständig. Ebenso ist sie feuerhemmend und brennt nicht. Wolle ist sehr dehnfähig und lässt sich bis zu 70% ihrer Länge strecken. Durch den hohen Anteil an eingeschlossener Luft zwischen den Fasern sind Wollstoffe sehr temperaturausgleichend.
Moderne Schurwollstoffe sind in der Regel chemisch ausgerüstet, d.h. ihnen wurde das Wollfett (Lanolin) zum größten Teil entzogen, sie sind motten- und filzsicher, maschinenwaschbar und damit relativ geruchsneutral und pflegeleicht. Leider gehen mit dieser Behandlung auch viele positive Eigenschaften der Wolle verloren, da wir heute flauschig-weiche, pflegeleichte Wolle bevorzugen und Wetterfestigkeit nicht mehr oberste Priorität hat.
nach obenUnsere Schafe gehören zur nordeuropäischen Rasse der Guteschafe, die archäologisch bis in die Eisenzeit nachweisbar ist. Farbe und Gehörnform ähneln denen der wilden Stammformen des Urials und des Mufflons. Guteschafe sind heute überwiegend auf Gotland (Schweden) beheimatet. Leider ist ihr Bestand auch dort gefährdet.Auffallend sind die Hörner bei beiden Geschlechtern. Die weiblichen Tiere (Auen) tragen schlanke Sichelhörner, während die Böcke stattlich gedrehte Hörner aufweisen, die bis zu 90 cm lang werden können. Guteschafe bekommen im Frühjahr ihre ca. 2-3 kg schweren Lämmer, oft auch Zwillinge und sind sehr gute, wachsame Eltern. Ausgewachsen können Auen ein Gewicht von ca. 60 kg, Böcke bis zu 100 kg erreichen. Leittier einer Herde ist meistens eine ältere, erfahrene Aue.
Das sehr dichte Fell besteht aus feinfaseriger Grundwolle, gröberen Deckhaaren und Markhaaren (Tothaaren). Die Farbe variiert über die ganze Grauskala, oft mit weißgrauer Grundfarbe und einem braunen Einschlag. Böcke tragen eine ausgeprägte Mähne. Dieses funktionale Fell ermöglicht es ihnen ganzjährig im Freien zu leben. Einige Guteschafe verfügen noch über einen natürlichen Fellwechsel, so dass man bei ihnen die alte Wolle einfach mit der Hand abziehen kann, ohne scheren zu müssen. Jedoch ist die so gewonnene Wolle oft sehr verfilzt und zum Spinnen ungeeignet.
Unsere Schafe sind eine sogenannte Zwienutzrasse, die uns wertvolle Rohwolle, haltbare Felle und gutes, wildbretartiges Fleisch liefern.
nach obenSchafe haben durch jahrtausendelange Zucht die Fähigkeit zum natürlichen Fellwechsel zum größten Teil verloren. Einmal im Jahr, meistens im Frühsommer, wird deshalb die Wolle geschoren. Die weichste Wolle erhält man bei der Herbstschur der Jahreslämmer, was allerdings eine Winteraufstallung erforderlich macht.Zum Scheren benutzt man die sogenannte Bügelschere, eine aus einem Stück geschmiedete Schere, die mit der Hand zugedrückt wird und sich von selbst wieder öffnet.
Nach Möglichkeit sollte die gesamte Wolle an einem Stück bleiben (Vlies), nur die stark verschmutzten Bauch- und Afterpartien werden sofort aussortiert. Soll die Wolle gefärbt werden, empfiehlt es sich, die Markhaare ebenfalls auszusortieren, da diese keine Farbe annehmen.Das Vlies wird in lauwarmem Seifenwasser gewaschen, gründlich gespült und anschließend sorgfältig getrocknet. Wichtig ist, nicht das ganze Wollfett herauszuwaschen, da dieses die Fasern geschmeidig und wasserabweisend hält. Stroh und sonstiger Schmutz werden mit der Hand aussortiert.nach obenDie Wolle muß nun für das Spinnen vorbereitet werden, d.h. die einzelnen Haare müssen parallelisiert werden, da sich nur so ein gleichmäßiger Faden spinnen lässt.Hierzu eignet sich das Kardieren. Die Wollfasern werden zwischen zwei Nagelbrettchen gestreckt und in eine Richtung geordnet. Kurze und lange Fasern werden nicht getrennt. Dieses Streichgarn ergibt relativ grobe, gut wärmende Stoffe.
Feineres, glänzendes Garn erhält man durch das Kämmen der Wolle. Bei diesem Vorgang werden mittels zweier mehrreihiger, langzahniger Kämme kurze Fasern ausgekämmt und nur die gleichmäßig langen weiterverarbeitet. Die Ausbeute beim Kammgarn ist sehr viel geringer als beim Streichgarn, aber nur aus gekämmter Wolle lassen sich sehr hochwertige, feine Gewebe herstellen.nach obenDie kardierten bzw. gekämmten Fasern werden nun durch Drehung der Spindel verdrillt, so dass aus den einzelnen Haaren ein durchgängiger, gleichmäßiger Faden, das Garn, entsteht. Häufig werden zwei oder mehr Garne nochmals miteinander zum belastbareren Zwirn versponnen.Die Hand- oder Fallspindel besteht aus einem ca. 30 cm langen geraden Holzstab. Am unteren Ende befindet sich der sogenannteWirtel, ein Schwunggewicht, das meist aus Ton, aber auch Stein, Knochen oder Holz, hergestellt wurde. Eine kleine Nut am oberen Ende des Stabes dient zur Aufnahme des Fadens, damit er beim Spinnen nicht vom glatten Holz abrutscht.
Nach dem Verspinnen wird das Garn auf eine Haspel gewickelt und am besten über Nacht ins Freie gestellt. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit entspannen sich die Fasern, verlieren ihren Drall und lassen sich ohne Verheddern weiterverarbeiten.
nach obenWeben ist die kreuzweise Verbindung von senkrechten Kett- und waagerechten Schussfäden zu einem zusammenhängenden Gewebe. Dies geschah im 13. Jhd. überwiegend auf dem Trittwebstuhl, in früheren Jahrhunderten mit dem aufrecht stehendenGewichtswebstuhl.Während die Konstruktion des Gewichtwebstuhles an die gewünschte Breite des Gewebes angepasst werden konnte, ist die Webbreite beim Trittwebstuhl vom Webkamm begrenzt. Die Einrichtung und Verschnürung eines Webstuhles dauert oft länger als das Weben selbst.
Da die Kettfäden sehr viel Spannung aushalten müssen, verwendet man für die Kette häufig Zwirne, während für die Schussfäden einfach versponnenes Garn ausreicht.
nach obenDurch unterschiedliche Arten der Fadenverkreuzungen ergeben sich die Bindungen. Zu den geläufigsten zählen die Leinwand- oder Tuchbindung, dieKöperbindung und Atlasgewebe.Je höher die Anzahl der Überkreuzungen, desto fester wird das Gewebe. Je unverkreuzter und dadurch glatter die Fäden verlaufen, desto glänzender und glatter wirkt der Stoff (z.B. Seide).

Leinwandbindung

Köperbindung

Atlasbindung
Die übliche Maßeinheit für Stoff war die Elle, jedoch konnte die absolute Größe der Elle regional sehr unterschiedlich ausfallen. Unter Einbeziehung verschiedener zeitgenössischer Texte erscheint es sinnvoll, eine Elle mit ca. 45 cm anzunehmen.
nach obenGeht man nach den vielen farbenprächtigen Miniaturen, die uns aus dem Mittelalter noch erhalten sind, beschränkte man sich nicht auf die natürliche Farbpalette, die naturfarbige Wolle lieferte. Gefärbt wurde mit pflanzlichen und tierischen Farbstoffen sowohl Garn zur Musterwebung als auch fertige Tuche.Geläufige pflanzliche Farbstoffe sind Krapp, Waid, Reseda/Färberwau und Walnuß, tierische Farbstoffe gewinnt man aus Kermesläusen und Purpurschnecken.
Zu den pflanzlichen Farbstoffen zählen:
Krapp (Rubia tinctorum) ist ein klettenähnliches, mehrjähriges Gewächs, dessen Wurzeln den begehrten roten Farbstoff enthalten. In der Regel erntet man die meterlangen, gelben Wurzeln (Rhizom) im 3. Jahr, erst dann ist die Pigmentkonzentration hoch genug. Erst durch die Trocknung entwickelt sich der rote Farbstoff. Krapp ist relativ hitzeempfindlich, weshalb man ihn nicht über 55°C erhitzen sollte, da der Farbstoff sonst in Brauntöne ausfällt.
Waid (Isatis tinctoria) war bis zur Einführung des ergiebigeren Indigos nahezu der einzige Farbstoff für Blautöne. Die zweijährige, rosettenförmige Pflanze entwickelt im zweiten Jahr eine bis zu 2m hohe gelbe Blühte und blaue Samenschoten.
Mit dem Waideisen werden die Blätter abgestochen, ohne das Herz der Pflanze zu verletzen. Der Waid treibt sofort wieder aus. In klimatisch günstigen Gegenden sind so bis zu 6 Ernten pro Jahr möglich.
Die frisch geernteten Blätter müssen schnell verarbeitet werden, da sich der Farbstoff an der Luft sehr schnell zersetzt. Nach dem Quetschen und Zerkleinern der Blätter (früher geschah dies in Göpelmühlen) wird das Mus zu Haufen aufgeschichtet, fermentiert, zu etwa faustgroßen Ballen geformt (den sogenannten Waidkugeln) und getrocknet. Dieser Prozeß ist notwendig, um den empfindlichen Farbstoff dauerhaft erhalten zu können. In dieser Form war Waid im 13. Jhd. ein begehrtes Exportgut, das besonders Thüringen zu wirtschaftlichem Wohlstand gebracht hat. Das Färben mit Waid ist recht aufwendig, da der eigentliche Farbstoff nur in einer Vorstufe (Indican) vorliegt und nicht wasserlöslich ist. Er muß erst aufgespalten und an der Luft oxidiert werden. Seit der synthetischen Herstellung von Indigo ist der Waid nahezu vollständig verschwunden. Mittlerweile gibt es aber wieder Bemühungen, Waid anzubauen und zu nutzen. Anwendungsbereiche sind hierbei hauptsächlich Restauration, Holzschutz und sogar Wärmedämmplatten lassen sich aus dem "Abfall" noch herstellen.
Wau (Reseda lutea u. R. luteola) ist eine der ältesten Färbepflanzen. Der gelbe, lichtechte Farbstoff (Luteolin) ist in Blättern, Stengeln und Samen enthalten.
Walnuß, genauer gesagt die grüne Außenhülle der Walnuß, färbt braun. Durch die in den Schalen enthaltenen Gerbstoffe ist ein zusätzliches Beizen der Wolle nicht erforderlich.
Eichenrinde enthält wie die Walnuß ebenfalls sehr viel Gerbsäure. Mit Eisensulfatbeize färbt sie Wolle tiefbraun bis schwarz. Um dem Farbton mehr Tiefe und Glanz zu verleihen, wurde der schwarze Ton häufig mit Waid überfärbt. Durch diese aufwendige Doppelfärbung war schwarzes Tuch sehr teuer und lange Zeit dem Klerus vorbehalten. Erst zum Ende des Spätmittelalters wurde er zur Modefarbe auch für das Bürgertum.
Zu den tierischen Farbstoffen zählen:
Kermes (Kermes vermillo), eine Schildlausart, die bevorzugt auf Eichen lebt, war ein teurer und begehrter Farbstoff für leuchtende Rottöne („Venezianer Scharlach“) und kann bis in die Vorgeschichte zurückverfolgt werden.
Purpur war der kostbarste Farbstoff der Antike und des Mittelalters. Aus dem Sekret von 10.000 Purpurschnecken läßt sich 1 Gramm Farbstoff gewinnen. Wie Waid ist Purpur ein Küpenfarbstoff, der erst an der Luft zu einem rotvioletten Farbton oxidiert. Seit dem Fall von Byzanz 1453 ist echter Purpur nahezu bedeutungslos in der Färberei. Ein Gramm dieses Farbstoffes kosten heute ca. 2000€!
Zum Färben werden die getrockneten Farbstoffe möglichst fein gemahlen, in Wasser gelöst und die Wolle der Färberlösung zugegeben. Damit sich die Pigmente dauerhaft mit der Wollfaser verbinden und nicht nur oberflächlich anhaften, muß deren Schuppenschicht, die normalerweise eine geschlossene Oberfläche bildet und wasserabweisend wirkt, aufgeschlossen werden. Dies erreicht man durch das Beizen der Wolle (z.B. Alaun) vor oder auch während des eigentlichen Färbevorgangs. Die Wahl der Beize beeinflusst das Färbeergebnis, auch Beigaben von bspw. Eisen, Kupfer oder Kleie führen zu unterschiedlichen Farbtönen. Mischtöne (z.B. grün) lassen sich durch Doppelfärbungen erreichen (z.B. Waid und Reseda).
Da Wolle unter Druck und Hitze schnell zum Verfilzen neigt, sind Temperaturschocks und zu heftiges Bewegen des Färbegutes unbedingt zu vermeiden. Bei langsamem Erhitzen kann man Wolle jedoch sogar kochen, was allerdings einige Farbstoffe nicht vertragen (z.B. Krapp). Grundsätzlich kann auch kalt gefärbt werden, jedoch dauert es mehrere Tage, bis die Wolle komplett durchgefärbt ist. Nach dem Färben wird die Wolle gespült und getrocknet.
Da Wolle unter Druck und Hitze schnell zum Verfilzen neigt, sind Temperaturschocks und zu heftiges Bewegen des Färbegutes unbedingt zu vermeiden. Bei langsamem Erhitzen kann man Wolle jedoch sogar kochen, was allerdings einige Farbstoffe nicht vertragen (z.B. Krapp). Grundsätzlich kann auch kalt gefärbt werden, jedoch dauert es mehrere Tage, bis die Wolle komplett durchgefärbt ist. Nach dem Färben wird die Wolle gespült und getrocknet.
Färben ist eine Kunst und Wissenschaft und die Färberei hat im Mittelalter vielen Städten zu großem Reichtum und Ansehen verholfen. Betrachtet man erhaltene Kleidungsstücke aus dieser Zeit, revidiert man schnell sein Bild vom grauen, eintönigen Mittelalter. Allerdings sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass die Färberei ein gewinnträchtiger Berufszweig war, Färberezepte wohlgehütete Betriebsgeheimnisse darstellten und der Handel mit Farbstoffen hoch besteuert wurde. Inwieweit die überwiegend bäuerliche Gesellschaft Möglichkeiten zum aufwendigen Färben ihrer Kleidung hatten, bleibt fraglich. Auch wenn viele Pflanzenfarben leicht zu beschaffen waren (Birkenblätter, Beeren und Flechten), so darf doch angezweifelt werden, ob das nötige Equipment für eine Heißfärbung in einer dörflichen Gemeinschaft vorhanden war. Um 5 m Wollstoff am Stück zu färben, benötigt man beispielsweise einen Kessel mit ca. 100 Liter Fassungsvermögen. Funde solcher Kessel sind uns aus diesem Bereich bisher nicht bekannt.
nach obenDa Kleidung in erster Linie vor Witterungseinflüssen schützen sollte, mußten die Stoffe entsprechend strapazierfähig, wasserabweisend, winddicht und wärmend sein. Hält man Stoff gegen das Licht, erkennt man unzählige "Löcher" im Gewebe, durch die nicht nur Licht, sondern auch Wind und Nässe dringen können, was durch das entsprechende Ausrüsten des Gewebes eingeschränkt werden kann. Dazu dienten bei Wollgeweben hauptsächlich folgende Methoden:Das in der Wolle enthaltene Wollfett (Lanolin) hält die Fasern geschmeidig und bereits relativ wasserabweisend.
Um das Gewebe weiter zu verdichten, kann man es walken. D.h. unter Druck (Treten des Stoffes mit dem Füßen), Wärme und Zugabe einer Walkflüssigkeit (z.B. Tonerde und heißem Wasser) quellen die Fasern auf und verfilzen miteinander, so daß die Weblöcher geschlossen werden und ein gleichmäßiges dichtes Tuch entsteht. Diese Art der Walke ist bereits seit der Bronzezeit bekannt. Später gab es auch spezielle Walkmühlen, deren Benutzung allerdings abgabepflichtig war.
Zur weiteren Veredelung von Wollgeweben nach dem Walken gehört das Aufrauhen mit Wollkratzern oder Kardedisteln. In diesem gerauhten Gewebe bilden sich isolierende Luftpolster, die sowohl vor Kälte als auch vor Wärme schützen. Die so behandelten Stoffe ähneln unseren heutigen Lodenstoffen.




































%20-21%2025.jpg)

















.JPG)

_-_James_Tissot.jpg)

















.jpeg)










.jpg)
































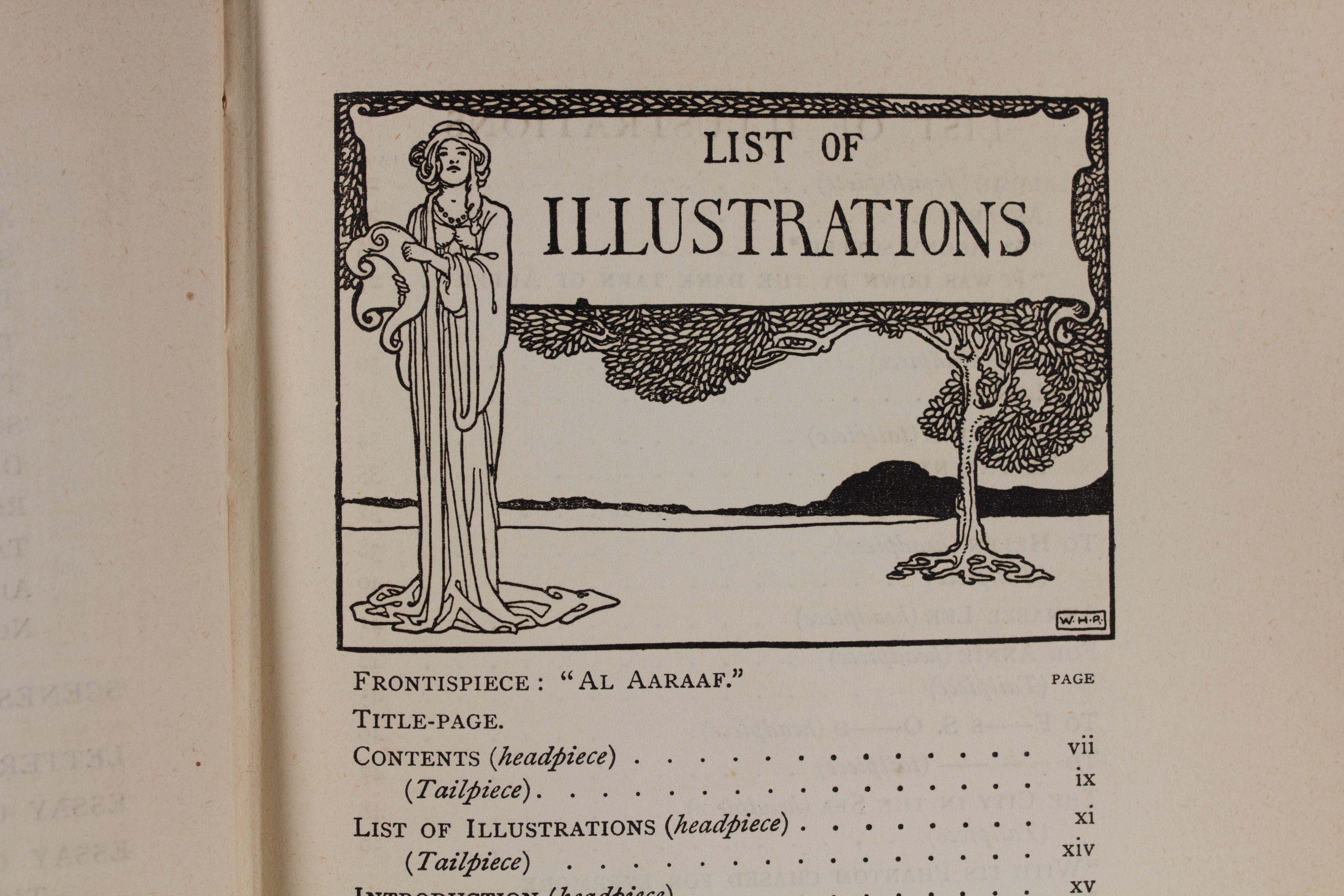



























.jpg)































.JPG)
.JPG)



























































































































































.jpg.JPEG)















.jpg)








.JPEG)
































































+(800x294).jpg)
































.mp4_snapshot_00.32.57_%5B2024.03.31_19.45.13%5D.jpg)



















.jpg)






























































































































































































































































































































































.jpg)







.jpg)

















































































 ca.org/webcast/compieta_1.mp3" target="_b
ca.org/webcast/compieta_1.mp3" target="_b










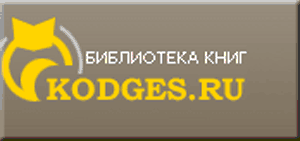
































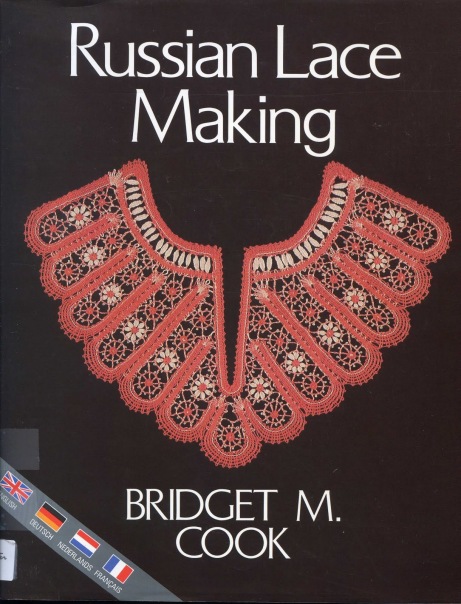
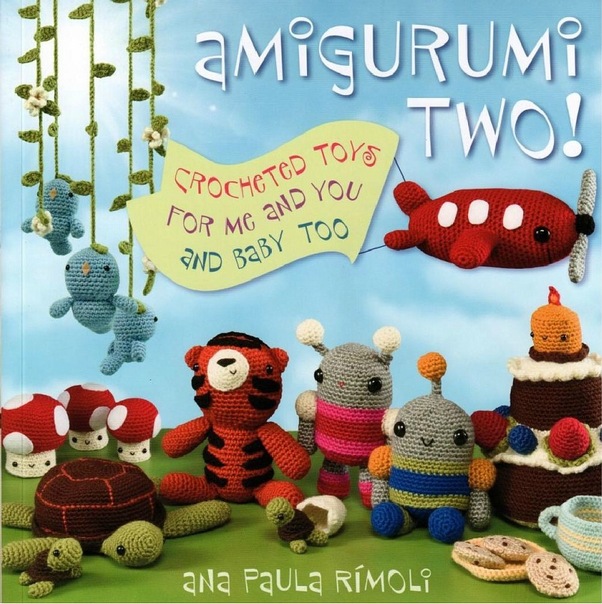










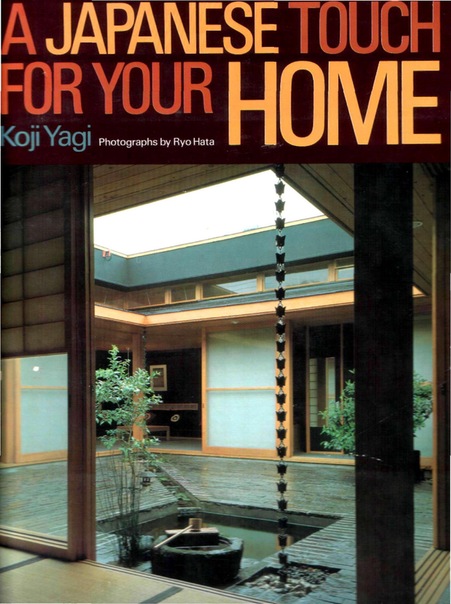
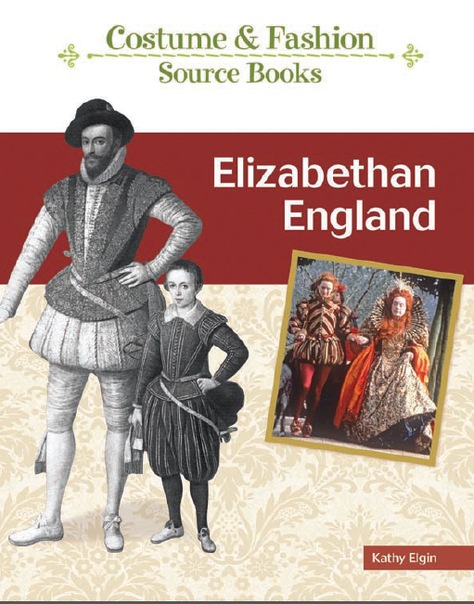
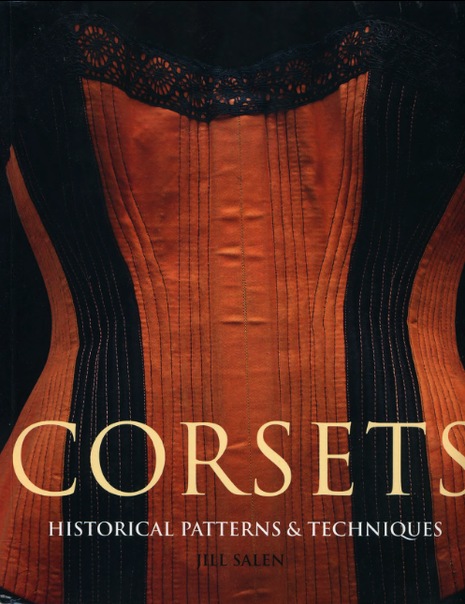


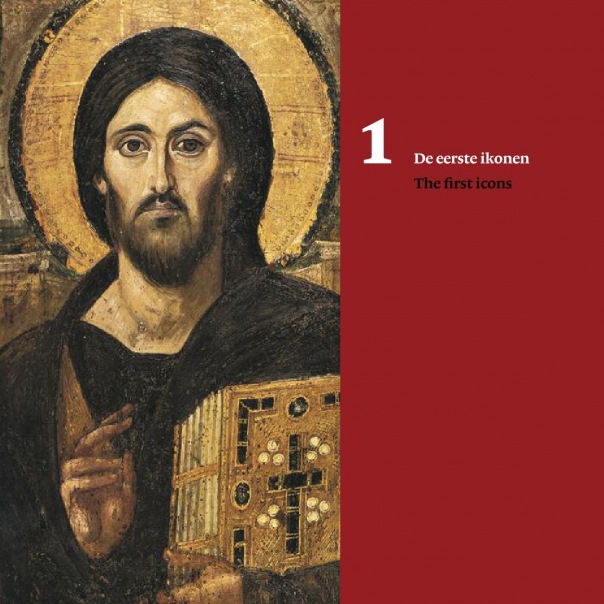



No comments:
Post a Comment